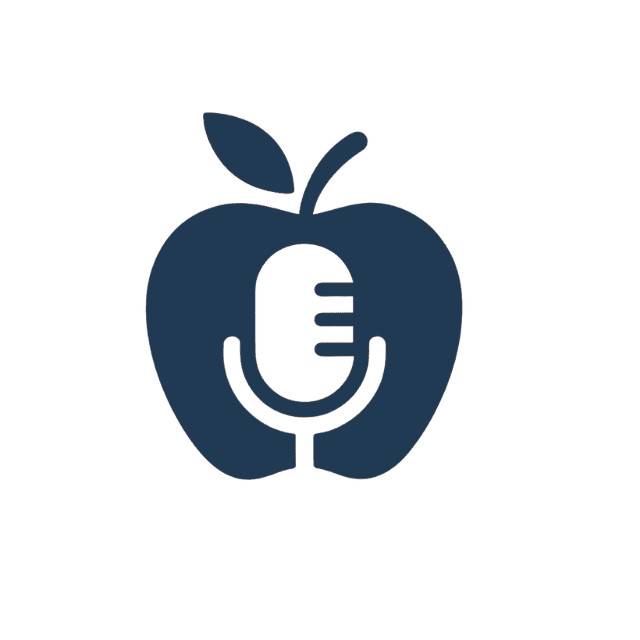Ob Gewichtszunahme trotz Diät, ständige Müdigkeit, Verdauungsprobleme oder unerklärliche Blutwerte: Hinter solchen Beschwerden kann sich eine Störung des Stoffwechsels verbergen. Doch was genau bedeutet das eigentlich – und wie erkennt man eine Stoffwechselstörung zuverlässig? In diesem Artikel erfährst du, welche diagnostischen Methoden heute zur Verfügung stehen, wann sie sinnvoll sind und wie du gemeinsam mit deinem Arzt oder deiner Ärztin Licht ins Dunkel bringen kannst.
Was versteht man unter einer Stoffwechselstörung?
Der Stoffwechsel (Metabolismus) umfasst alle biochemischen Vorgänge im Körper, mit denen Nährstoffe verarbeitet, Energie bereitgestellt und Abfallstoffe ausgeschieden werden. Wenn dieser komplexe Prozess an einer oder mehreren Stellen gestört ist, spricht man von einer Stoffwechselstörung.
Solche Störungen können angeboren oder im Laufe des Lebens erworben sein. Manche sind harmlos, andere lebensbedrohlich. Viele verlaufen schleichend und werden erst spät entdeckt – oft durch unspezifische Symptome, die leicht mit anderen Ursachen verwechselt werden.
Typische Beispiele für Stoffwechselstörungen sind:
- Schilddrüsenerkrankungen (Unter- oder Überfunktion)
- Diabetes mellitus (Zuckerstoffwechsel)
- Fettstoffwechselstörungen (z. B. erhöhte Cholesterinwerte)
- Harnsäurestoffwechselstörungen (z. B. Gicht)
- Eiweißstoffwechselstörungen
- Störungen im Kalzium- oder Knochenstoffwechsel (z. B. Osteoporose)
- angeborene Stoffwechselkrankheiten (z. B. Phenylketonurie)
Die richtige Diagnostik hilft, Ursachen zu erkennen, Risiken zu vermeiden und gezielte Behandlungsstrategien zu entwickeln.
Welche Symptome können auf eine Stoffwechselstörung hinweisen?
Die Beschwerden sind oft unspezifisch und werden lange nicht mit dem Stoffwechsel in Verbindung gebracht. Besonders aufmerksam solltest du werden, wenn du über längere Zeit unter einem oder mehreren der folgenden Anzeichen leidest:
- Unerklärliche Gewichtszunahme oder -abnahme
- Chronische Müdigkeit oder Leistungsschwäche
- Stimmungsschwankungen, Depression, Nervosität
- Kälte- oder Hitzeempfindlichkeit
- Verdauungsprobleme (Verstopfung, Durchfall, Blähungen)
- Muskel- oder Gelenkbeschwerden
- Haarausfall, trockene Haut, brüchige Nägel
- Zyklusstörungen, Libidoverlust
- erhöhter Blutdruck oder hoher Blutzucker
Diese Symptome sind ernst zu nehmen – insbesondere, wenn sie länger anhalten oder sich verschlechtern. Dann ist eine gezielte Diagnostik ratsam.
Welche Ärzt:innen sind die richtigen Ansprechpartner?
Je nach Art der Beschwerden und dem vermuteten Bereich des Stoffwechsels beginnt die Diagnostik oft beim Hausarzt oder der Hausärztin. Diese können erste Untersuchungen veranlassen und dich bei Bedarf an Fachärzt:innen überweisen, etwa:
- Endokrinologie: für Hormon- und Stoffwechselerkrankungen
- Diabetologie: für Diabetes und verwandte Störungen
- Gastroenterologie: bei Verdacht auf Magen-Darm-bezogene Stoffwechselstörungen
- Nephrologie: bei Beteiligung der Nieren
- Ernährungsmedizin: zur ganzheitlichen Begleitung
Die Wahl hängt immer vom individuellen Beschwerdebild ab.
Welche diagnostischen Methoden gibt es bei Stoffwechselstörungen?
Moderne Medizin bietet eine Vielzahl an Untersuchungen, mit denen sich Stoffwechselstörungen zuverlässig erkennen oder ausschließen lassen. Die wichtigsten Verfahren stelle ich dir im Folgenden vor.
1. Anamnese und körperliche Untersuchung
Am Anfang steht immer das Gespräch: Seit wann bestehen die Beschwerden? Wie haben sie sich entwickelt? Gibt es familiäre Vorbelastungen? Welche Medikamente werden eingenommen? Auch Lebensgewohnheiten wie Ernährung, Bewegung, Schlaf und Stress werden erfragt.
Die körperliche Untersuchung kann Hinweise auf typische Veränderungen geben – z. B. Über- oder Untergewicht, Hautveränderungen, Schwellungen, Herz- und Kreislaufbefunde oder sichtbare Stoffwechselzeichen wie Xanthome (Fettablagerungen in der Haut).
2. Blutuntersuchungen: Das wichtigste Diagnoseinstrument
Bluttests sind zentral bei der Diagnostik von Stoffwechselstörungen. Sie liefern direkte Hinweise auf die Funktion von Organen, Hormonen und Nährstoffhaushalt. Wichtige Laborwerte sind unter anderem:
- Blutzucker (nüchtern, HbA1c): zur Erkennung von Diabetes oder Prädiabetes
- Cholesterin, LDL, HDL, Triglyzeride: zur Beurteilung des Fettstoffwechsels
- TSH, fT3, fT4: Schilddrüsenfunktion
- Harnsäure: bei Verdacht auf Gicht
- Leber- und Nierenwerte: Stoffwechsel und Entgiftungsleistung
- Vitamin D, Kalzium, Phosphat, Parathormon: Knochenstoffwechsel
- Eiweiß- und Aminosäurenstatus: Proteinverwertung
- Insulin, C-Peptid: Insulinproduktion und Resistenz
Je nach Verdacht können zusätzliche Spezialparameter erhoben werden – etwa Hormone der Nebenniere oder Hypophyse, genetische Marker oder Autoantikörper.
3. Urin- und Stuhluntersuchungen
Bestimmte Stoffwechselprodukte werden über den Urin oder Stuhl ausgeschieden. Eine Analyse kann Hinweise auf Nierenfunktion, Zuckerausscheidung, Eiweißverlust oder auch Entzündungen und Fehlbesiedlungen im Darm geben.
Urinstatus, 24-Stunden-Sammelurin oder spezielle Teststreifen (z. B. auf Ketone, Eiweiß, Nitrit) gehören zu den Basisuntersuchungen.
Stuhluntersuchungen kommen z. B. bei Verdacht auf Verdauungsenzyme-Störungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Darmerkrankungen zum Einsatz.
4. Bildgebende Verfahren
Wenn die Laborwerte auffällig sind oder körperliche Veränderungen bestehen, können bildgebende Verfahren weiterhelfen. Dazu zählen:
- Ultraschall (Sonographie): zur Beurteilung von Leber, Nieren, Schilddrüse, Bauchspeicheldrüse
- MRT/CT: bei unklaren Organbefunden oder Tumorverdacht
- Knochendichtemessung (DEXA): bei Verdacht auf Osteoporose
- Szintigrafie: zur Funktionsdiagnostik der Schilddrüse oder Nebennieren
Diese Verfahren geben Einblick in Struktur und Funktion von Organen und helfen, Ursachen für Stoffwechselveränderungen besser zu verstehen.
5. Belastungstests und Funktionsprüfungen
Manche Stoffwechselstörungen zeigen sich erst unter bestimmten Bedingungen. Dafür gibt es spezielle Tests:
- Glukosetoleranztest (oGTT): zur Diagnose von Diabetes oder Insulinresistenz
- Laktose-/Fruktose-Atemtests: bei Verdacht auf Zuckerunverträglichkeiten
- Hormonstimulationstests: z. B. ACTH-Test bei Nebenniereninsuffizienz
- Thermogenesetest: zur Einschätzung der Stoffwechselrate unter Kältereiz
Solche Tests werden meist unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt und ergänzen die Basisdiagnostik.
6. Genetische und molekulare Diagnostik
Bei Verdacht auf seltene, angeborene Stoffwechselkrankheiten oder bei familiärer Häufung bestimmter Erkrankungen kann eine genetische Untersuchung sinnvoll sein. Sie identifiziert bestimmte Genveränderungen, die mit dem Krankheitsbild in Verbindung stehen.
Auch bei personalisierter Therapieplanung – etwa in der Onkologie oder Prävention – gewinnen genetische Marker zunehmend an Bedeutung.
7. Metabolom- und Mikrobiomanalysen (moderne Verfahren)
Neue diagnostische Ansätze analysieren die Gesamtheit der Stoffwechselprodukte (Metabolom) oder die Zusammensetzung der Darmflora (Mikrobiom). Sie bieten tiefere Einblicke in individuelle Stoffwechselmuster, sind aber (noch) nicht Bestandteil der Routineversorgung.
In spezialisierten Praxen oder Forschungsprojekten können sie helfen, chronische Beschwerden besser zu verstehen – z. B. bei Reizdarm, chronischer Erschöpfung oder unklaren Gewichtsentwicklungen.
Wie geht es nach der Diagnose weiter?
Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt meist im Gespräch mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin. Dabei werden Befunde erklärt, mögliche Ursachen eingeordnet und Behandlungswege besprochen.
Je nach Art und Schwere der Störung kann die Therapie umfassen:
- Ernährungsumstellung oder gezielte Nährstofftherapie
- Bewegungstherapie und Stoffwechseltraining
- Medikamentöse Behandlung (z. B. Hormone, Enzyme, Stoffwechselhemmer)
- Begleitung durch Ernährungsberater:innen oder Psycholog:innen
- Regelmäßige Verlaufskontrollen
Ziel ist immer, die Stoffwechselprozesse wieder ins Gleichgewicht zu bringen, Beschwerden zu lindern und Folgeerkrankungen zu vermeiden.
Fazit: Stoffwechsel verstehen – und gezielt untersuchen lassen
Stoffwechselstörungen sind häufiger als gedacht – und sie betreffen nicht nur seltene Erkrankungen, sondern auch Volkskrankheiten wie Diabetes, Schilddrüsenprobleme oder Fettstoffwechselstörungen. Oft bleibt die Ursache hinter Symptomen wie Müdigkeit, Gewichtszunahme oder Verdauungsproblemen lange unentdeckt.
Die gute Nachricht: Mit modernen diagnostischen Methoden lassen sich viele dieser Störungen frühzeitig erkennen – und gezielt behandeln. Wer seine Symptome ernst nimmt, sich untersuchen lässt und die Zusammenhänge versteht, hat beste Chancen auf mehr Lebensqualität, Gesundheit und Energie.